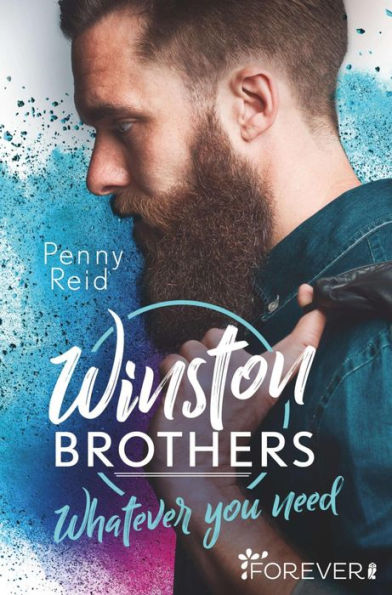Verzweifelt verliebt in einen Winston Brother!
"Bis jetzt der beste Band der Winston-Brothers! Jedes Mal, wenn ich dachte, es könnte nicht besser werden hat Penny Reid noch eins draufgelegt. Ich bin restlos begeistert!" (Katrin P., Buchhändlerin, auf NetGalley)
Jennifer Sylvester möchte sicher nicht für immer die Bananenkuchenkönigin von Tennessee bleiben. Aber als Mädchen aus gutem Hause, mit dem Schuldirektor als Vater und einer Mutter, die die lokale Popularität und das hübsche Gesicht ihrer Tochter nur zu gern vermarktet, ist Jennifer in Sachen Liebesleben echt verzweifelt. Aber schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auftritt: Cletus Winston, der eben diese besondere Lösung für Jennifers Singleleben sein könnte. Aber auch wenn Cletus sich für sonst ziemlich clever und faszinierend hält, ist er von Green Valleys Golden Girl Jennifer mehr als überrascht. Und was tut ein gewiefter Bad Boy im Falle von Gefühlen? Wahrscheinlich nicht das, was du denkst …
Von Penny Reid sind bei Forever erschienen:
In der Winston-Brothers-Reihe:
Wherever you go
Whatever it takes
Whatever you need
Whatever you want
Whenever you fall
When it counts
When it's real
Verzweifelt verliebt in einen Winston Brother!
"Bis jetzt der beste Band der Winston-Brothers! Jedes Mal, wenn ich dachte, es könnte nicht besser werden hat Penny Reid noch eins draufgelegt. Ich bin restlos begeistert!" (Katrin P., Buchhändlerin, auf NetGalley)
Jennifer Sylvester möchte sicher nicht für immer die Bananenkuchenkönigin von Tennessee bleiben. Aber als Mädchen aus gutem Hause, mit dem Schuldirektor als Vater und einer Mutter, die die lokale Popularität und das hübsche Gesicht ihrer Tochter nur zu gern vermarktet, ist Jennifer in Sachen Liebesleben echt verzweifelt. Aber schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auftritt: Cletus Winston, der eben diese besondere Lösung für Jennifers Singleleben sein könnte. Aber auch wenn Cletus sich für sonst ziemlich clever und faszinierend hält, ist er von Green Valleys Golden Girl Jennifer mehr als überrascht. Und was tut ein gewiefter Bad Boy im Falle von Gefühlen? Wahrscheinlich nicht das, was du denkst …
Von Penny Reid sind bei Forever erschienen:
In der Winston-Brothers-Reihe:
Wherever you go
Whatever it takes
Whatever you need
Whatever you want
Whenever you fall
When it counts
When it's real


eBookAuflage (Auflage)
Available on Compatible NOOK devices, the free NOOK App and in My Digital Library.
Related collections and offers
Overview
Verzweifelt verliebt in einen Winston Brother!
"Bis jetzt der beste Band der Winston-Brothers! Jedes Mal, wenn ich dachte, es könnte nicht besser werden hat Penny Reid noch eins draufgelegt. Ich bin restlos begeistert!" (Katrin P., Buchhändlerin, auf NetGalley)
Jennifer Sylvester möchte sicher nicht für immer die Bananenkuchenkönigin von Tennessee bleiben. Aber als Mädchen aus gutem Hause, mit dem Schuldirektor als Vater und einer Mutter, die die lokale Popularität und das hübsche Gesicht ihrer Tochter nur zu gern vermarktet, ist Jennifer in Sachen Liebesleben echt verzweifelt. Aber schwierige Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Auftritt: Cletus Winston, der eben diese besondere Lösung für Jennifers Singleleben sein könnte. Aber auch wenn Cletus sich für sonst ziemlich clever und faszinierend hält, ist er von Green Valleys Golden Girl Jennifer mehr als überrascht. Und was tut ein gewiefter Bad Boy im Falle von Gefühlen? Wahrscheinlich nicht das, was du denkst …
Von Penny Reid sind bei Forever erschienen:
In der Winston-Brothers-Reihe:
Wherever you go
Whatever it takes
Whatever you need
Whatever you want
Whenever you fall
When it counts
When it's real

Product Details
| ISBN-13: | 9783958182721 |
|---|---|
| Publisher: | Forever |
| Publication date: | 09/03/2018 |
| Series: | Green Valley , #3 |
| Sold by: | Bookwire |
| Format: | eBook |
| Pages: | 420 |
| File size: | 3 MB |
| Language: | German |
About the Author

Penny Reid ist USA Today Bestseller-Autorin der Winston-Brothers-Serie und der Knitting-in-the-city-Serie. Früher hat sie als Biochemikerin hauptsächlich Anträge für Stipendien geschrieben, heute schreibt sie nur noch Bücher. Sie ist Vollzeitmutter von drei Fasterwachsenen, Ehefrau, Strickfan, Bastelqueen und Wortninja.
Sybille Uplegger studierte englische und amerikanische Literaturwissenschaft und Philosophie in Bamberg und Seattle, ehe sie nach Berlin zog, um dort als freie Übersetzerin zu arbeiten. In ihrer Freizeit erkundet die sportbegeisterte Mutter eines Sohnes verschiedene Laufstrecken rund um die Hauptstadt oder ist mit ihrem Bogen auf dem Schießplatz anzutreffen.
Read an Excerpt
CHAPTER 1
Jennifer
Ich stand jeden Morgen auf und backte Kuchen.
Dabei zog ich es vor, nicht in großen Mengen zu backen. Kuchen in großen Mengen zu backen ist nämlich ungefähr so, als würde man eine ganze Horde Kinder großziehen und von ihnen erwarten, dass sie sich alle genau gleich verhalten. Oder als wollte man jeden See in Tennessee in exakt derselben Zeit durchschwimmen.
Sofern es mir möglich war, widmete ich mich immer nur einem Kuchen auf einmal. Jeder Kuchen hatte seine ganz eigene Persönlichkeit, und wenn man diese Persönlichkeit nicht respektierte, bekam man unweigerlich die Quittung dafür. Dann wurde der Kuchen nämlich widerspenstig oder langweilig.
Ich wollte keine widerspenstigen Kuchen backen. Eigentlich wollte ich im Moment überhaupt keine Kuchen backen. Aber wenn ich schon Kuchen backen musste, dann sollten es großartige Kuchen werden. Kuchen, die Spaß machten. Kuchen mit hochfliegenden Träumen. Temperamentvolle Kuchen, die immer und überall auffielen.
Absolut einzigartige Kuchen.
»Bist du schon mit der Bestellung aus Knoxville fertig?«, rief Momma von nebenan. Ich hatte sie gar nicht hereinkommen hören. Ihr Ton war schrill und leicht panisch, und das löste auch bei mir Panik aus. »Ich schwöre bei der gebratenen Hühnerleber deiner Großmutter Lilly, wenn du die Kuchen wieder alle einzeln backst, dann erwürge ich dich.«
Ich straffte die Schultern und schluckte den Speichel hinunter, der mir vor lauter Nervosität im Mund zusammengelaufen war. Die gebratene Hühnerleber meiner Großmutter Lilly war nicht nur köstlich und ein streng gehütetes Geheimnis – wie die meisten unserer berühmt-berüchtigten Familienrezepte –, sondern sie konnte, mit genügend Kraft und in tödlicher Absicht geschleudert, auch erhebliche Verletzungen hervorrufen.
Mit großer Sorgfalt stellte ich den letzten Kuchen in seine Schachtel.
Und ja, ich hatte sie in der Tat alle einzeln gebacken und dekoriert – so wie immer. Bedeutete das, dass ich mich in aller Herrgottsfrühe aus dem Bett quälen musste? Ja, das bedeutete es. Musste ich das meiner Mutter gegenüber zugeben? Nein, das musste ich nicht. Es war besser, vor Sonnenaufgang aufzustehen, als den guten Menschen von Barbern langweiligen Kuchen anzudrehen.
»Bin gleich fertig!«, rief ich zurück und machte mich ans Aufräumen. Wenn sie sah, dass ich die kleine Küchenmaschine verwendet hatte, würde sie Zustände bekommen. Hastig stopfte ich alle benutzten Rührschüsseln und Messbecher in einen der Schränke im hinteren Bereich der großen, professionell ausgestatteten Backstube. Dann lief ich zurück, um die Küchenmaschine zu holen. Ich nahm sie auf den Arm und taumelte unter ihrem Gewicht.
Als ich das Klackern von Absätzen hörte, wurde mir klar, dass ich keine Zeit mehr haben würde, das Gerät zu verstecken. Also stellte ich es kurzerhand auf den Boden und warf meine Schürze darüber. Dann wirbelte ich herum, gerade noch rechtzeitig, bevor meine Momma im Türrahmen auftauchte.
»Gott sei Dank.« Sie hatte die Hände in die Hüften gestemmt und war wie immer perfekt zurechtgemacht.
Ihre blonden, zu Wellen gelegten Haare sahen aus wie ein Helm, und vermutlich fühlten sie sich auch so an. Ihr Make-up war makellos, dick wie eine Kuchenglasur und stoßfest wie eine Hockeymaske. Eine Wolke aus Chanel No. 5, Nagellackgeruch und Aqua-Net-Haarspray wehte drei Sekunden nach ihr in den Raum.
Ihr äußeres Erscheinungsbild war Waffe und Rüstung zugleich.
Kritisch begutachtete sie den Zustand der Backstube. Ihr Blick blieb an der großen Küchenmaschine hängen. Sie war blitzsauber.
»Wo sind denn die anderen? Wer hat das alles saubergemacht?«
»Ich.« Ich stieg über die kleine Küchenmaschine am Boden hinweg und hoffte inständig, dass sie meiner Mutter nicht auffallen würde. »Ich habe die Mitarbeiter früher nach Hause geschickt, es war ja nur die eine Bestellung.«
Sie sah mich an. »Was ist denn das bitte für ein Lumpen?«, fragte sie mit unüberhörbarer Missbilligung.
Ich schaute an mir herab. Ich hatte ganz vergessen, was ich heute Morgen angezogen hatte. »Äh ... eine Latzhose.«
»Oh, Jennifer!« Sie sagte meinen Namen leise und gepresst, als wäre er ein Schimpfwort. »Eine Dame trägt doch keine Latzhosen.«
»Nancy Danvish trägt Latzhosen.« Von Nancy Danvish bezogen wir unsere Eier und unsere Milch. Ihre Hühner und ihre Kühe waren sehr glücklich, deshalb legten sie die besten Eier und gaben die beste Milch. Glückliche Eier und glückliche Milch ergaben glückliche Kuchen.
»Nancy Danvish ist eine Bäuerin.«
»Aber sie ist trotzdem eine Dame.«
»Darüber kann man sich streiten ...«, grummelte meine Mutter und hätte fast die Augen verdreht. »Und gütiger Himmel, deine Haare! Und dein Gesicht, pfui.« Halblaut fügte sie noch hinzu: »Manchmal frage ich mich wirklich, von welchem Planeten du stammst. Von diesem hier ganz sicher nicht.«
Ich presste die Lippen aufeinander, um nicht »Danke« zu sagen.
Das war so eine Eigenart von mir: Ich bemühte mich immer, so zu tun, als wären unhöfliche Bemerkungen in Wahrheit bloß ungeschickt formulierte Komplimente, denn so war es für alle Beteiligten angenehmer. Die Bemerkung meiner Momma beispielsweise hätte in Wahrheit auch Folgendes bedeuten können: Du bist ein Wesen von einem anderen Stern.
Diese Angewohnheit hatte mir im Laufe meines Lebens schon oft gute Dienste geleistet, sowohl wenn ich in der Stadt unterwegs war, als auch zu Hause im Umgang mit meinen Eltern. Bestimmt wäre sie auch in der Schule nützlich gewesen, allerdings war ich nie zur Schule gegangen. Meine Momma hatte mich und meinen Bruder zu Hause unterrichtet.
Als Rhea Mathis einmal während der Chorprobe in der Kirche zu mir gesagt hatte, ich würde »so gut hier reinpassen wie ein Vegetarier auf ein Grillfest«, war das lediglich ihre Art gewesen, mir mitzuteilen, wie einzigartig ich sei. Und als Timothy King mich mit fünfzehn bei der Jam Session am Freitagabend als »steif wie eine tote Katze« bezeichnet hatte, hatte ich mich bei ihm bedankt, weil er meine Bescheidenheit und Zurückhaltung gelobt hatte. Und als zwei der Finalistinnen des Tortenwettbewerbs auf der alljährlichen landwirtschaftlichen Leistungsschau mir mitteilten, dass sie mich für vollkommen talentfrei hielten, hatte ich diese nette Bemerkung über meinen Fleiß mit einem Lächeln quittiert.
»Hallo? Erde an Jennifer? Hör auf, Löcher in die Luft zu starren. Du musst dich beeilen.«
»Was?«
Momma hielt ihr Handy in der einen Hand und wedelte mit der anderen vor meinem Gesicht herum. »Du hast heute noch einen Termin mit Sheriff James.«
»Ach ja?« Das war mir neu.
»Ja. Ich habe ihn heute Morgen zufällig auf dem Parkplatz vor dem Piggly Wiggly getroffen und ihn gefragt, wie ihm und seinen Deputys die Cupcakes geschmeckt hätten, die wir ihnen geschickt haben. Und natürlich hat er in den höchsten Tönen von ihnen geschwärmt. Wie dem auch sei, eins führte zum anderen und am Ende hat er sich bereit erklärt, ein Testimonial mit dir aufzunehmen.«
»Aha ...« Ich nickte matt. Meine Kehle war auf einmal staubtrocken. Ich versuchte zu lächeln.
»Was ist mit deinem Gesicht los? Hast du Magenschmerzen?«
»Nein.« Ich gab mir mehr Mühe mit dem Lächeln. »Aber Momma, du weißt doch, dass ich nicht gern solche Videos mache.«
»Sprich laut und deutlich, Jennifer. Du nuschelst schon wieder. Ich mag es nicht, wenn du nuschelst.«
Ich räusperte mich. »Ich mache nicht gern solche Videos. Ich bin dann immer so nervös, und die Kommentare im Netz ...«
»Ach, die bösen Kommentare darfst du gar nicht lesen, Kleines. Es gibt nun mal gehässige Menschen auf der Welt. In Wahrheit können die einem nur leidtun.« Sie trat zu mir, legte mir die Hände auf die Schultern und schüttelte mich leicht. »Denk daran, wie gut das Gästehaus läuft, seit wir letztes Jahr die Social-Media-Kampagne gestartet haben. Denk daran, wie die Bäckerei floriert. Denk an das viele Geld, das wir verdienen. Denk daran, wie du überall auf der Welt bewundert wirst. Du bist ein Star.«
»Aber die viele Aufmerksamkeit ... Und die Leute in der Stadt –«
»Die Leute in der Stadt können uns egal sein. Du und ich, wir sind zu Höherem bestimmt. Komm schon, du weißt doch, wie hübsch du in diesen Videos aussiehst, deine Abonnenten sind immer ganz begeistert davon. Du bist so unglaublich telegen – wenn du geschminkt bist und nicht wie eine Bäuerin herumläufst, versteht sich. Na, geh und zieh dich um, sei so gut. Ich habe dem Sheriff gesagt, dass du heute Nachmittag vorbeikommst.«
»Aber kannst du nicht –«
»Jennifer!« Die Finger meiner Mutter gruben sich in meine Arme, und sie schloss für einen langen Moment die Augen, als müsse sie sich sammeln. »Du stellst meine Geduld wirklich auf eine harte Probe, Schätzchen. Hast du eine Ahnung, was ich heute alles noch zu erledigen habe? Muss ich dich daran erinnern, dass Ende des Monats die Investoren wegen des Gästehauses kommen? Ich brauche dich, Jennifer. Du bist hier der Dreh- und Angelpunkt. Wenn du mich enttäuscht, ist alles verloren. Seit dein Bruder weg ist ...« Das Kinn meiner Mutter bebte, und sie blickte an die Zimmerdecke. In ihren Augen schimmerten Tränen.
Sofort hatte ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ihr unnötigen Kummer bereitete. Ich wusste ja, wie sehr sie unter der Abwesenheit meines Bruders litt. Ich wusste, wie tief getroffen sie gewesen war, als Isaac den Kontakt zur Familie abgebrochen hatte. Mein Vater schien recht schnell über den Verlust hinweggekommen zu sein, aber Momma trauerte immer noch. Mir zerriss es jedes Mal fast das Herz vor Sehnsucht, wenn ich an meinen Bruder dachte – nicht auszudenken, wie es erst meinen Eltern gehen musste.
Sie atmete zitternd aus, schniefte diskret und sah mich an. »Ich bitte dich, Jenny. Bitte sei mir eine Stütze. Bitte lass mich nicht im Stich.«
Ich verkniff mir jeden weiteren Protest und ordnete meine Gesichtszüge so, dass sie an ein schmallippiges Lächeln erinnerten.
Als sie seufzte, schwang darin Erleichterung mit. Sie nahm mein Gesicht in ihre Hände und sah mich liebevoll an. »Gut, gut. Und jetzt geh und zieh dich um, und dann fährst du zum Sheriff und nimmst das Video mit ihm auf. Den Rest des Tages hast du dann frei.« Unter ihrem maskenhaften Make-up nahm ich einen Anflug von Besorgnis wahr. »Um wie viel Uhr bist du eigentlich heute aufgestanden? Du siehst müde aus.«
»Mir geht's gut.«
Sie musterte mich noch eine Zeit lang mit mütterlicher Fürsorge, bevor ihr Handy einen Summton von sich gab. Sie warf einen Blick auf den Bildschirm, schnaubte unwillig und ließ meine Schultern los. »Da muss ich rangehen. Wie gesagt, das mit dem Sheriff solltest du heute unbedingt noch erledigen. Und danach schreibst du vielleicht einem deiner Brieffreunde, oder du legst dich hin und ruhst dich ein bisschen aus.«
Zum vielleicht zehnmillionsten Mal in meinem Leben sagte ich: »Mache ich, Momma.«
Doch sie hörte gar nicht mehr zu. Sie hing bereits am Telefon. »Hallo? Hallo, ja, richtig, hier spricht Diane Donner-Sylvester. Ja, ganz herzlichen Dank für den Rückruf ...« Sie verließ die Küche, und ihre Stimme und das Geräusch ihrer Absätze wurden immer leiser.
Und weil ich ein braves Mädchen war, tat ich, was sie mir aufgetragen hatte.
* * *
Ich beobachte Menschen.
Zum einen, weil sie oft sehr seltsame Dinge tun und sagen, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Aber vor allem beobachte ich Menschen, weil fast niemand in Green Valley gewillt ist, mit mir über etwas anderes zu reden als über Kuchen.
»Da kommt die Bananenkuchenkönigin«, verkündete Flo McClure gedehnt. Sie bemannte – oder vielmehr: befraute – den Empfangstresen im Sheriffbüro und hob bei meinem Eintreten kaum den Blick von ihrem Computermonitor. Ohne mich anzusehen oder darauf zu warten, dass ich etwas sagte, wies sie mich an: »Nehmen Sie Platz, Kindchen. Der Sheriff erwartet Sie, aber es dauert noch ein paar Minuten.«
»Danke schön, Miss McClure.«
Die ältere Frau kniff ihre Augen zusammen, die die Farbe von Kiefernzapfen hatten, und lächelte höflich, um mir zu signalisieren, dass sie mich zwar vernommen hatte, ihr aber die Zeit oder die Muße fehlte, sich auf eine Unterhaltung mit mir einzulassen.
Ich lebte in einer Kleinstadt, wo jeder jeden kannte. Flo – mit vollständigem Namen Florence – McClure war die unverheiratete Schwester von Carter McClure, dem Leiter der hiesigen Feuerwehr. Sie war als starrsinnige alte Jungfer verschrien. Die Leute behaupteten, sie hätte trotz mehrerer Anträge von verschiedenen Männern nie geheiratet, weil sie ihre Unabhängigkeit bewahren wollte.
Ich allerdings hegte den Verdacht, dass es nicht ihre Unabhängigkeit war, deren Verlust sie fürchtete. Vor fünf Jahren während der Parade zum vierten Juli hatte ich sie bei einem heimlichen, aber sehr leidenschaftlichen Wortwechsel mit Nancy Danvish beobachtet. Ich wäre bereit gewesen, mein gesamtes Geld darauf zu verwetten, dass sie sich insgeheim zu Frauen hingezogen fühlte.
Wie dem auch sei. In Green Valley kannten sich alle untereinander, und alle kannten mich. Ich war die Bananenkuchenkönigin. Ich backte auch noch viele andere Dinge, aber berühmt war ich für meinen Bananenkuchen. Deshalb wurde ich auch normalerweise wie folgt vorgestellt: »Das hier ist Jennifer Sylvester. Sie wissen schon – die Bananenkuchenkönigin. Sie ist berühmt für ihren Bananenkuchen.«
Aber ich schweife ab.
Ich kehrte Flo McClure den Rücken zu und suchte mir einen Stuhl in der Ecke des kleinen Eingangsbereichs. Ich legte das eingewickelte Zucchini-Walnuss-Brot, das ich mitgebracht hatte, auf meinen Schoß, überkreuzte die Beine an den Knöcheln und wartete.
Ich mochte den Sheriff. Er war sehr nett. Er redete nicht viel, fragte mich aber immer, wie es mir ging, und er hatte ein freundliches, aufrichtiges Lächeln. Außerdem gefiel es mir, dass er so ein hingebungsvoller Vater und Ehemann war. Die Leute in seinem Bezirk lagen ihm wirklich am Herzen. Er war ein guter Mensch. Und deshalb brachte ich ihm etwas Selbstgebackenes mit.
Die nächste Viertelstunde verbrachte ich damit, die Leute auf der Wache zu beobachten und die Social-Media-Benachrichtigungen auf meinem Handy zu ignorieren. Ich pflegte meine Accounts nicht selbst, bekam aber trotzdem immer alle Benachrichtigungen auf mein Smartphone geschickt.
Hannah Townsen kam herein. Sie hielt schnurstracks auf den Empfangstresen zu und begann eine lebhafte Diskussion mit Flo über einen Bußgeldbescheid wegen zu schnellen Fahrens. Einige Augenblicke später tauchten die King-Brüder in der großen Tür auf, die zu den eigentlichen Büros führte. Sie tuschelten leise miteinander.
Ich zog abwehrend die Schultern hoch und machte mich auf einen vulgären Kommentar oder ein eindeutiges Angebot gefasst. Doch es kam keins.
Die zwei wirkten mitgenommen, sogar ein bisschen verängstigt, und bemerkten mich gar nicht, als sie mit schnellen Schritten in Richtung Ausgang eilten. Auch von Flo und Hannah nahmen sie keine Notiz.
Ich wunderte mich nicht, die King-Brüder auf der Polizeiwache zu sehen. Als rangniedere Mitglieder der Iron Wraiths – dem größten und gefährlichsten Motorradclub der Gegend – kamen sie häufiger mit dem Gesetz in Konflikt.
Wann immer sie mich alleine antrafen, handelte ich mir eine anzügliche Bemerkung von ihnen ein. Das ging seit meiner Jugendzeit so.
Doch heute war offenbar eine Ausnahme. Ich seufzte erleichtert.
Dann richtete ich meine Aufmerksamkeit wieder auf Flo und Hannah, deren Unterhaltung sich mittlerweile Hannahs Mutter zugewandt und einen deutlich freundschaftlicheren Ton angenommen hatte.
Mrs Townsen hatte einige Jahre zuvor einen Autounfall gehabt, und Hannah hatte sie ganz allein gepflegt, obwohl sie damals erst siebzehn Jahre alt gewesen war. Um die Familie durchzubringen, hatte sie zwei Jobs annehmen müssen: als Kellnerin im Front Porch und in der Fabrik von Payton Mills. Vor etwa zwei Jahren hatte sie dann die Stelle in der Fabrik gekündigt, um stattdessen als Stripperin im Pink Pony anzufangen.
Das Telefon klingelte, und Flo hob einen Finger, ehe sie den Hörer abnahm. »Warten Sie ganz kurz, Hannah, da muss ich rangehen. Ja?« Ihr Blick glitt kurz zu mir, dann nickte sie. »Jawohl, die ist hier.«
Unwillkürlich setzte ich mich aufrechter hin, als auch Hannah sich nach mir umdrehte. Sie taxierte mich von oben bis unten und konnte sich nur mit Mühe ein Augenrollen verkneifen.
Ich machte ihr keinen Vorwurf daraus, wirklich nicht. Wir waren im gleichen Alter und hatten früher zusammen im Kirchenchor gesungen. Ich konnte ihre Verachtung für mich gut verstehen.
Ich gab ein ziemlich extremes, geradezu lächerliches Bild ab: toupierte und gewellte wasserstoffblonde Haare; rosafarben lackierte Acrylnägel; High Heels. Seit ich sechzehn war, ließ mich Momma nur noch geschminkt aus dem Haus gehen, einschließlich falscher Wimpern. Wenn man die Schönheitswettbewerbe mitzählte, an denen ich als Kind teilgenommen hatte, hatte das mit dem Make-up sogar noch früher angefangen. In der Öffentlichkeit trug ich ausschließlich Gelb oder Grün, denn diese Farben waren mein Markenzeichen, seit ich vier Jahre alt war. Ich trug immer Kleider, diese Kleider gingen mir immer bis zum Knie, und ich hatte immer eine Perlenkette um den Hals.
(Continues…)
Excerpted from "Winston Brothers Whatever You Need"
by .
Copyright © 2018 Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin.
Excerpted by permission of Ullstein Buchverlage.
All rights reserved. No part of this excerpt may be reproduced or reprinted without permission in writing from the publisher.
Excerpts are provided by Dial-A-Book Inc. solely for the personal use of visitors to this web site.